Ein Versuch, das Wissen über Depressionen und ihre Ursachen zu erweitern.
Was sind die Ursachen von Depressionen?
Die Ursachen der Depression sind leider nur unzureichend bekannt. Sicherlich sind Ansichten, die die Ursachen dieser Krankheit auf einen einzigen Faktor reduzieren, wie Stress, Persönlichkeitsschwäche, eine bestimmte „depressive“ Denkweise, eine Stoffwechselstörung des Serotonins, (endogene) genetische Defekte und andere, falsch, auch wenn sie manchmal an Popularität gewinnen. Zu diesen vereinfachten Ansichten über die Ätiologie der Depression gehört die Unterteilung in endogene, reaktive und somatogene Depression, die in der polnischen Literatur gut belegt ist. Diese Aufteilung entspricht kaum der Realität. Es gibt zu viele Gründe für die Annahme, dass die Ätiologie der Depression äußerst komplex ist, viele pathogene Faktoren umfasst und einen langfristigen Prozess darstellt. Pathogene Faktoren sind wahrscheinlich bei verschiedenen Menschen in unterschiedlicher Stärke
und in verschiedenen Konstellationen vorhanden. Bei der Pathogenese können einige dieser Faktoren bei einer bestimmten Person nicht vorhanden sein, aber die Stärke anderer kann ausreichen, damit sich die Krankheit manifestiert.
Faktoren, die zu Depressionen führen
Dazu gehören:
- eine genetische Veranlagung, die noch wenig erforscht ist und wahrscheinlich mit einer unterschiedlichen Expression von Genen zusammenhängt, die mit bestimmten Neurotransmittersystemen verbunden sind.
- schwierige Lebensereignisse in der Kindheit, insbesondere wiederholte Ereignisse
und von beträchtlicher Stärke, die chronischen Stress verursachen, was zumindest bei einigen Menschen zu einer anhaltenden Überreaktion der biologischen Stressmechanismen führt. - eine bestimmte Art der Persönlichkeitsentwicklung, die sich möglicherweise parallel zu ungünstigen Lebenserfahrungen in der Kindheit und Jugend herausbildet und die Grundlage für emotionale Empfindlichkeit, geringere Leistungsfähigkeit im sozialen Bereich und übermäßige Bereitschaft zu innerem Stress ist. (An dieser Stelle sei auf die Bedeutung von Merkmalen wie Pessimismus, Selbstzweifel, übermäßige Kritik an sich selbst und anderen, Perfektionismus, übermäßige Abhängigkeit von der Anerkennung und Akzeptanz anderer, Unfähigkeit, Wut auszudrücken und nach außen zu richten, hingewiesen)
- biologisch bedingte Empfindlichkeit gegenüber saisonalem Sonnenlichtdefizit
- aktueller Stress („unmittelbare Vorerkrankung“, oft chronisch)
Was ist die Achse des langfristigen Prozesses, der zu einer Depression führt? Nach einer interessanten Hypothese, die inzwischen immer besser belegt ist, könnte es sich um eine unterschiedliche Stressreaktivität handeln. Sie betrifft vor allem die so genannte Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Achse. Bei Menschen mit Depressionen, und bei einigen von ihnen schon lange vor ihrer Depression, reagiert dieses System anders, nämlich mit einer übermäßigen Ausschüttung typischer Stresshormone und einem Mangel an physiologischer Hemmung. Das wichtigste Stresshormon des Menschen, Cortisol, wirkt physiologischerweise auch als eine Substanz, die Stressmechanismen hemmt. Es gibt Hinweise darauf, dass dieser Selbsthemmungsmechanismus bei depressiven Menschen nicht richtig funktioniert. Die Werte vieler Substanzen, die unter Stress ausgeschüttet werden, einschließlich Corticoliberin und einiger entzündungsfördernder Zytokine, sind deutlich höher. Dies führt zu Veränderungen in der Funktion der Zentren, die die Stimmung, den Impuls und die Emotionalität regulieren, sowie zu einer Störung einer Reihe von natürlichen Biorhythmen und Gedächtnismechanismen. In den letzten Jahren wurde die Hypothese aufgestellt, dass Depressionen auch zu morphologischen Veränderungen der Gehirnzellen führen, die allerdings reversibel sein können. Es wurden Veränderungen beschrieben, die sowohl eine Abnahme der Gesamtgröße eines wichtigen subkortikalen Kerns, des Hippocampus, als auch eine Abnahme der Anzahl seiner Zellen beinhalten. Die Forschung hat auch Veränderungen aufgezeigt, die mit einer Verarmung der neuronalen Bulben und veränderten synaptischen Verbindungen einhergehen. Andererseits wird eine Normalisierung der Zellmorphologie unter dem Einfluss von Antidepressiva beschrieben, sowie eine Normalisierung der Erregung der gesamten Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Achse.
Die heutigen Vorstellungen über die Ätiologie der Depression weichen nicht so sehr von den früheren Überlegungen über intrasynaptische Phänomene und die Rolle der Mediatoren (Serotonin und Noradrenalin) ab, sondern erweitern vielmehr die Sichtweise auf die Mechanismen der Depression. Die Verknüpfung der biologischen Mechanismen der Depression mit chronischem Stress untergräbt die traditionelle Einteilung dieser Krankheit. Zu den neuen Konzepten gehört die Einsicht, dass es sich bei der Depression um eine körperliche Störung handelt, bei der die Mechanismen der menschlichen Biologie erheblich gestört sind, aber auch um eine Krankheit, die mit schwierigen Lebensereignissen, Problemen beim Erreichen von Lebenszielen, Lebensstress und vielleicht sogar mit einem bestimmten Persönlichkeitstypus zusammenhängt. Nur ein solches Modell ermöglicht es uns zu verstehen, dass die Behandlung von Depressionen häufig eine Kombination aus pharmakologischer Behandlung und psychologischer Unterstützung erfordert.
Der Weg zur Depression
Nach dem oben skizzierten Verständnis der Depression geht den klinischen Symptomen der Krankheit ein langer Prozess der Entwicklung präklinischer Prädispositionen und Manifestationen voraus. Bei einigen Menschen mit einer bestimmten genetischen Veranlagung kann dieser Prozess bereits beginnen. Das Vorhandensein bestimmter Genvarianten (Allele), die möglicherweise Proteine für wichtige Neurotransmitter und Transportproteine kodieren, prädisponiert, wenn auch wahrscheinlich nicht in ausreichendem Maße, für die spätere Erkrankung. Dann kann es in einem frühen Stadium des Lebens dieser Person zu schwächenden, schwerwiegenden Lebensereignissen kommen, die den Charakter eines psychologischen Traumas haben. Dies kann zum Beispiel der Tod von Personen sein, die dem Kind nahe stehen, eine Situation des Verlassenseins, Armut, Sucht oder Gewalt.
Solche Ereignisse können einerseits zu einigen, wenn auch „harmlosen“ Veränderungen der Persönlichkeit und des Verhaltens führen, andererseits aber auch zu dauerhaften neurobiologischen Veränderungen, die in der Alltagsbeobachtung nicht leicht zu erkennen sind, insbesondere im endokrinen und autonomen Nervensystem, das unter Stress aktiv ist. Diese Veränderungen haben den Charakter einer Überempfindlichkeit, und Menschen, die noch mit Schwierigkeiten im Leben konfrontiert sind, reagieren stärker auf Stressreize, mit einer erheblichen Stimulation des Nervensystems und einer übermäßigen Ausschüttung von starken Substanzen, die die Stressreaktion vermitteln, darunter Glukokortikoide, Noradrenalin und Vermittler des Immunsystems (Cytokinine).
An einem bestimmten Punkt im Leben (vor dem Erwachsenenalter oder häufiger im Erwachsenenalter) wird diese häufige und übermäßige Aktivierung von Stress- und Immunmechanismen eindeutig pathologisch. Turbulenter Stress, ausgelöst durch aktuelle schwierige Lebensereignisse, insbesondere chronischer Natur, ebnet den Weg für bestimmte somatische Erkrankungen (wie Bluthochdruck, koronare Herzkrankheit), kann aber auch und vor allem zu einer Destabilisierung der intrazerebralen Mechanismen zur Regulierung von Stimmung und Emotionen führen, die sich in einer ausgeprägten klinischen Depression manifestieren.
Natürlich kann der individuelle Weg zu einer Depression sehr unterschiedlich sein und ist es auch. Störungen der Stressreaktion in der Zeit vor der Erkrankung sind nicht bei allen depressiven Personen vorhanden. Es gibt auch eine Untergruppe von Patienten, bei denen eine besondere Empfindlichkeit gegenüber Sonnenlicht sehr wichtig ist. Diese Empfindlichkeit geht entweder mit anderen krankmachenden Faktoren einher oder dominiert manchmal und bildet somit eine andere Art von Depression, die sogenannte saisonale Depression.
Autor des Artikels: Stanisław Porczyk, MD, Psychiater
Quelle: Institut für Gesundheitspsychologie
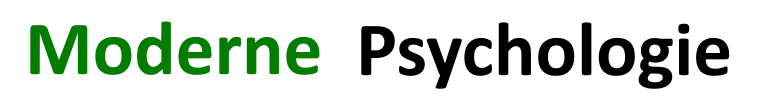











Letzte Kommentare